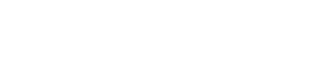22 Okt Filteranlagen für Hochtechnologieprozesse
Eine neue Filteranlage entfernt Schadstoffe aus der Umgebungsluft, wie sie bei Laserprozessen entstehen, auf sehr effiziente Weise. Sie kann den verschiedenen Materialien und freigesetzten Stoffen angepasst werden. Künftig soll die Technik auch in der additiven Fertigung zum Einsatz kommen.
Die Metallbearbeitung mit Lasern oder Plasma setzt Mikropartikel und andere gesundheitsschädliche Stoffe frei. Mit der Automatisierung, beispielsweise durch Fertigungsroboter, rückt der Emissionsschutz in den Hintergrund, weil Menschen nicht permanent anwesend sind. »Das ist problematisch, weil Mitarbeiter hin und wieder die Räume betreten müssen, um Schäden zu beheben, die Anlage zu warten oder die Qualität der Produkte zu überprüfen«, sagt Jens Friedrich, Gruppenleiter Gas- und Partikelfiltration am Fraunhofer IWS in Dresden. »Die Mitarbeiter werden dann im Unklaren darüber gelassen, wie stark die Luft tatsächlich belastet ist.«
Das Fraunhofer IWS hat daher zusammen mit Unternehmen aus Sachsen eine Filteranlage entwickelt, die die Luft in Produktionsräumen reinigt und dabei eine Vielzahl von Schadstoffen bindet. Standard sind heute Aktivkohle-Filteranlagen, die etwa flüchtige organische Substanzen, die sogenannten VOC, zurückhalten. In metallverarbeitenden Betrieben und Werkstätten kommen aber häufig Substanzen wie Formaldehyd, Stickoxide oder problematische Schwefelverbindungen hinzu. Das Laserschweißen setzt außerdem Mikropartikel aus Metall oder Schweißmaterial frei. Eine Anlage, die alle Substanzen gleichermaßen gut aus der Raumluft entfernt, gab es bislang nicht.
Zahlreiche Substanzen getestet
Im Projekt MultiFUN haben die Partner erstmals ein solches flexibles Filtersystem entwickelt. Es besteht aus mehreren, einzeln austauschbaren Modulen. Jede Filterebene enthält ein bestimmtes Filtermedium, das bestimmte Substanzen aus der Raumluft entfernt. Neben Aktivkohle kommen beispielsweise Zeolithe oder poröse Polymere zum Einsatz, aber auch sogenannte metallorganische Gerüstverbindungen.
Um die richtige Filtersubstanz zu finden, haben die Forscherinnen und Forscher des Fraunhofer IWS an einigen Substanzen getestet, wie gut sie die verschiedenen Luftschadstoffe adsorbieren. Die besten Kandidaten wurden dann in den Filteranlagen-Prototypen integriert, den das Unternehmen ULT aus Löbau gefertigt hat. Eine Besonderheit im Vergleich zu herkömmlichen Filteranlagen ist die Messsensorik, die erkennt, wann das Filtermedium mit Substanzen gesättigt ist und ausgetauscht werden muss. Der Zustand wird optisch über farbige LEDs für jede Filterebene und Schadstoffklasse separat angezeigt. Dementsprechend muss auch nur die jeweils betreffende Filterebene ausgetauscht werden.
Besser nicht auf Filteranlagen verzichten
Mit der zunehmenden Automatisierung steigt die Zahl an Fabrikräumen, in denen die Luft nur unzureichend gereinigt wird – beispielsweise auch bei 3-D-Fertigungsanlagen. »Das wird unweigerlich zu Konflikten führen, weil es nie ganz ohne Menschen geht«, sagt Jens Friedrich. »Es ist absolut sinnvoll, Filteranlagen einzusetzen, um permanent die Gesundheit der Mitarbeiter zu schützen – auch wenn diese die automatisierten Areale nur gelegentlich betreten.« Bei der Additiven Fertigung mit 3-D-Laserrobotern kommt hinzu, dass in größeren Mengen Mikropartikel frei werden, die auch den Raum und die Werkstücke verschmutzen, wenn sie sich ablagern. Die Partikel können hochwertige Produkte kontaminieren. Außerdem stellen sie eine Unfallgefahr da, weil man auf den Kügelchen ausrutschen kann, wenn sie sich auf dem Fußboden sammeln.
Zusammen mit mehreren Unternehmen entwickelt das Fraunhofer IWS derzeit eine Anlage, die auf die Filterung von Schadstoffen und Substanzen abgestimmt ist, die bei der additiven Fertigung frei werden. Auch für die Fertigung und das Recycling von Batterien sieht Jens Friedrich einen wachsenden Bedarf an Filteranlagen, die verschiedene Substanzen aus der Luft entfernen. Vor allem, weil dort Metalle wie Nickel, Mangan und Kobalt zum Einsatz kommen, die Verbindungen bilden können, die schon in sehr geringen Dosen gesundheitsgefährdend sind.
Quelle: www.iws.fraunhofer.de
Bild: Jürgen Jeibmann/Fraunhofer IWS